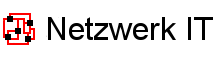Sonderkonzert des Quedlinburger Musiksommers
Quedlinburg 27.8.2013 Der ein Wiener Abend in Quedlinburg am 31.8.2013 besteht aus dem Liederzyklus Pierrot Lunaire von Arnold Schönberg, dem 1. Satz aus dem Klavierquartett op.47 Es-Dur von Robert Schumann und dem Flötenquartett D-Dur KV 285 von Wolfgang Amadeus Mozart.
zum Programm:
Pierrot Lunaire
Eine Auseinandersetzung zwischen Kunst und Gesellschaft Gegenwelten
Der Komponist Arnold Schönberg (1874-1951) hat das bis dahin geltende Tonsystem „demokratisiert“. Die Hierarchie der Töne wurde aufgelöst und nun galten z.B. c und cis plötzlich als gleichberechtigte Töne nebeneinander. In einer Oktave gab es jetzt 12 Töne, die vorher auch da waren, aber nicht so behandelt wurden. Es hat mir als Student viel Spass gemacht, aus diesem Repertoire an Tönen, Melodien zu bilden. Prinzip war, dass jeder Ton nur einmal vorkommen durfte. Die Kunst bestand darin, etwas sangbares zu entwickeln.
In der Komposition Pierrót Lunaire (1912) findet diese Kompositionsweise nur in spärlichen Ansätzen Anwendung. Um eines neuen Ausdrucks willen gibt Arnold Schönberg aber die Moll-Dur Tonalität auf. Und das zugunsten des Textes, der dem Werk zugrunde liegt. Es sind „Dreimal sieben Gedichte“ aus Albert Girauds (1860-1929) Pierrot Lunaire von 1884. Vereinfacht gesprochen handelt es sich um eine Folge phantastischer Szenen... .Im Zentrum der Visionen steht die Vorstellung , dass mit Einbruch der Nacht die Figur des Pierrot aus der Spielwelt der Commedia dell'arte heraufsteigt, als enfant terrible die bürgerliche Welt demaskiert ( 1. Teil), sich aber zugleich fremd und bedroht in ihr vorkommt ( 2.Teil) und beim Morgengrauen in die Welt der Komödie, der Kunst wieder zurücktaucht. Die Faszination für das die Nacht umspannende Geheimnis prägt sich sehr stark schon in der Romantik aus. Sie ist eine Antwort auf den, den Tag prägenden Inbegriff der bürgerlichen Arbeits-und Lebenswelt, der hervorgehoben ist vom Geschäftsgeist und Nützlichkeitsdenken. Die Nacht hat etwas Zauberisches, was kein Tag hat; so etwas Grenzenloses, Inniges, Seliges. Auch heute noch ist die Mondnacht im Bewusstsein der Menschen. „Memory“ aus „Cats“ zeugt davon.
Die Figur Pierrot ist ebenfalls ein „Gegenbild“. „In der Literatur der Romantik symbolisiert er den Künstler als Aussenseiter in der Gesellschaft, als Taugenichts, als umherziehenden Spielmann, Zigeuner usw.- ein Gegensatz zum Bürgerlichen, zum Kleinlichen, Begrenzten, Ordentlichen, Normalen.“ In der Zeit um 1820 begegnen wir erstmalig dem Pierrot als einem melancholischen Spassmacher. Auch der Maler Pablo Picasso nimmt die Figur des Pierrot in vielen Bildern auf.
Im ersten Teil seines Gedichtszyklus schwärmt der Dichter über das Mondlicht, das ihn trunken macht, das ihn an die Melancholie eines Chopinschen Walzers denken lässt. Zwischen den Zeilen ist aber auch die Sorge des Dichters zu spüren, dass die Welt der Poesie durch die „ Gedankenlosigkeit“ der Menschen bedroht ist.
Die Nacht hat auch eine bedrohliche Seite. Diese ist der ganze Gegensatz zum ersten Teil. Der zweite Teil zeigt unsere Welt, „deren Negativität in makabren Wahrträumen enthüllt wird.“ Dafür ist das Stück „ Rote Messe“ exemplarisch. Es bildet zugleich den Mittelpunkt des ganzen Zyklus.“ Pierrot – symbolisch die Künstlerexistenz symbolisierend – durchbricht als Priester beim grausen Abendmahl die kultische Fassade, bestehend aus dem Blendeglanz des Goldes und dem Flackerschein der Kerzen, reißt sich sein Herz aus dem Leibe und demonstriert es als triefend rote Hostie dem Unverständnis der bangen Seele. Der dritte Teil dagegen mutet wie ein Scherzando an. Pierrot ergreift das „Heimweh“ und er kehrt zurück in die Welt der Commedia dell`arte , nachträumend „dem Duft aus Märchenzeit“.
Nachdem die Schauspielerin und Sängerin Albertine Zehme (1857-1946) Schönberg gebeten hatte, ihr diesen Gedichtzyklus zu vertonen, äußert er sich so: „ Habe Vorwort gelesen, Gedichte angeschaut, bin begeistert. Glänzende Idee, ganz in meinem Sinn. Würde das auch ohne Honorar machen wollen...“ Er wählt die Form des um 1900 in Mode gekommenen Melodram. Dieses wiederum präsentiert den literarischen Text als Text und verwandelt ihn nicht in Gesang. Das ist das Prägende in diesem Stück. Der oder die Interpretin nutzen die Modulationsfähigkeit ihrer Sprechstimme, indem sie einer vorgegebenen Sprechmelodie folgen. Nur wenige vorgeschriebene Töne sollen gesungen werden. Damit kann der Text unmittelbar wirken. Die Instrumente unterstützen die vom Text ausgehende „Atmosphäre“.
Es mag sein, dass über den Inhalt hinaus auch die Form der Gedichte Arnold Schönberg zur Komposition angeregt haben. Es ist die Rondel – Form. Hier stellt die erste Zeile des Gedichts so etwas wie einen „Erfindungskern“ dar, der das ganze Gedicht bestimmt. Die erste Zeile erscheint zusammen mit der zweiten Zeile am Ende der zweiten Strophe wieder und wird am Ende der dritten Strophe noch einmal wiederholt.
1.„Mondestrunken“
Der Wein, den man mit Augen trinkt,
Gießt Nachts der Mond in Wogen nieder,
Und eine Springflut überschwemmt
Den stillen Horizont.
Gelüste, schauerlich und süß,
Durchschwimmen ohne Zahl die Fluten!
Den Wein, den man mit Augen trinkt,
Gießt Nachts der Mond in Wogen nieder.
Den Dichter, den die Andacht treibt,
Berauscht sich in dem heilgen Tranke,
Gen Himmel wendet er verzückt
Das Haupt und taumelnd saugt und schlürft er
Den Wein, den man mit Augen trinkt.
Albert Giraud (Belgien) – deutsche Nachdichtung Otto Erich Hartleben (1864-1905)
Text: Gottfried Biller
Quelle: Musikwerke im Unterricht, Band 4; Elmar Bozzetti/KlausTrapp – bosse musik paperback 1990
Interpreten:
- Conny Herrmann – Stimme
- Irina Chevtchenko – Klavier
Ensemble „Lunaire“:
- Carolin Ortwein – Querflöte, Piccolo-Flöte
- Johannes Reiche – Klarinette, Bassklarinette
- Michael Pöschke – Violine
- Matthias Erben – Viola
- Min Young Jeon – Violoncello
Leitung: KMD Gottfried Biller
Zu Beginn des Abends erklingen:
Robert Schumann (1810-1856) Klavierquartett op.47 Es-Dur – 1. Satz: Sostenuto assai-Allegro ma non troppo
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Flötenquartett D-Dur KV 285 Allegro-Adagio-Rondeau